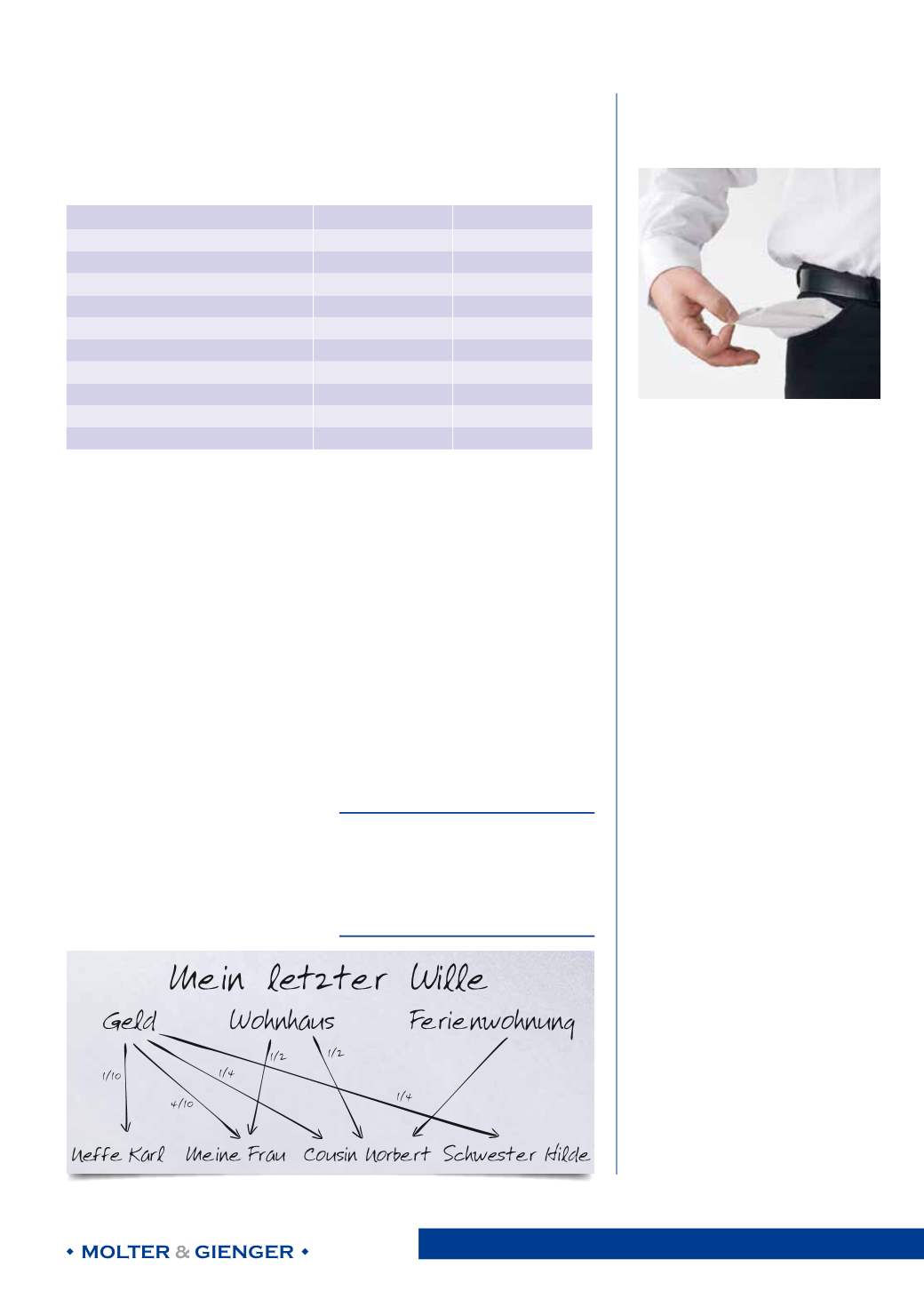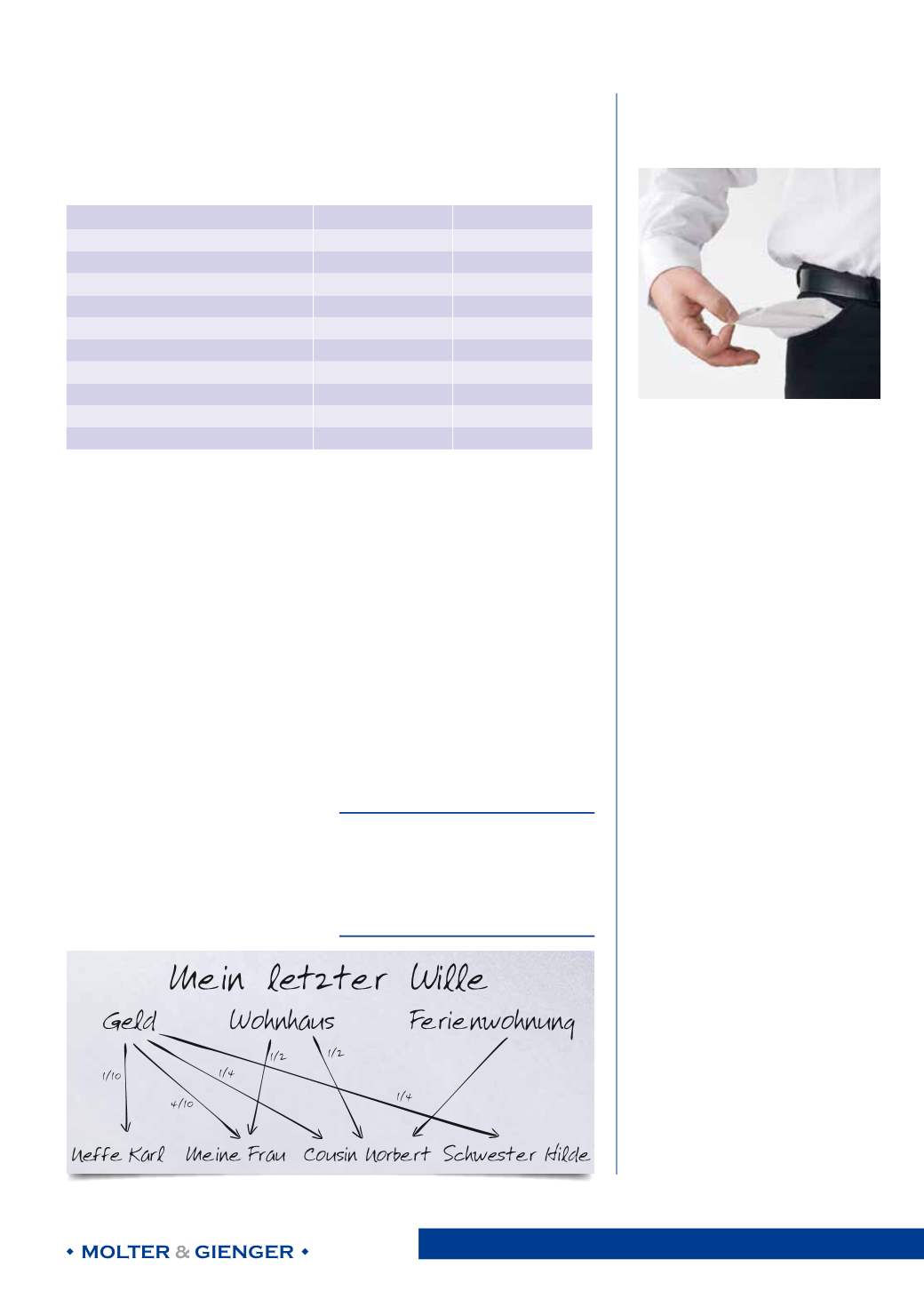
Wir beraten Sie gerne: Tel. 0 70 23 / 7 45 81 – 0
Die Differenzen im Einzelnen
Eine Auflistung der wichtigsten Unter-
schiede ist demSchaubild zu entnehmen.
Dabei ist zu beachten, dass der Investitions-
abzugsbetrag außerhalb der Bilanz erfasst
wird und die Steuerlast im Bildungsjahr
senkt. Latente Steuern entstehen dadurch,
dass steuerliches und handelsrechtliches
Ergebnis auseinanderfallen und der Steuer-
aufwand nicht zum HGB-Gewinn passt.
©MEV
Hat ein Mitarbeiter Schulden, müssen
Arbeitgeber mit Lohnpfändungen
rechnen. Fehler oder Versäumnisse
können dabei zu einer Haftung des
Arbeitgebers führen.
Ein Gläubiger kann durch den Antrag auf
Pfändung auf das Arbeitseinkommen des
Schuldners zurückgreifen. Notwendig dazu
ist ein vollstreckbarer Titel. Der Arbeitgeber
hat auf entsprechendes Verlangen inner-
halb von zwei Wochen zu erklären, ob und
welche Ansprüche bereits für andere Gläu-
biger gepfändet sind. Ihm ist untersagt,
den pfändbaren Teil des Arbeitseinkom-
mens an den Arbeitnehmer auszuzahlen.
Er ist sogar verpflichtet, die pfändbaren
Beträge zu ermitteln und an den Gläubiger
zu überweisen.
Pfändungsfreigrenzen
Der Arbeitgeber muss bei seiner Berech-
nung die von Zeit zu Zeit angepassten
Pfändungsfreigrenzen beachten.
Unpfändbar sind derzeit Nettoeinkommen
unter € 1.050 (keine unterhaltsberech-
tigte Person), unter € 1.440 (1 unter-
haltsberechtigte Person), unter € 1.660
(2 unterhaltsberechtigte Personen)
usw. Übersteigt das Einkommen diese
Grenzen, sind darüber hinausgehende
Beträge weiterhin unpfändbar, und zwar
zu drei Zehntel (keine unterhaltsberech-
tigte Personen), zwei weiteren Zehnteln
(1 Person) und je einem weiteren Zehntel
für die 2. bis 5. Person.
Pfändung wegen Unterhaltsansprüchen
Die Höhe der hier geltenden Pfändungs-
grenzen legt das jeweils zuständige
Vollstreckungsgericht fest.
A r b e i t s r e c h t
▸
Handelsbilanz
Steuerbilanz
selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter Aktivierungswahlrecht
Aufwand
Rückstellung drohende Verluste
Pflicht
nein
Pensionsrückstellung
Zins je nach Marktlage
Zins 6%
Rückstellungen (Laufzeit über 1 Jahr)
keine Abzinsung
idR Abzinsung
Verbindlichkeiten (Laufzeit über 1 Jahr)
keine Abzinsung
idR Abzinsung
steuerliche Sonderabschreibungen
nein
ja
Bildung Investitionsabzugsbetrag
nein
ja
Bilanzierung latente Steuern
a) Aktivposten
Wahlrecht
b) Passivposten
Pflicht
E r b r e c h t
Testament in Bildern
Genügt ein in Pfeildiagrammen verfasstes
Testament der gesetzlichen Schriftform?
Diese Frage beschäftigte kürzlich das
Oberlandesgericht Frankfurt.
Ein Ehemann hatte eigenhändig ein
Testament verfasst. Zur Darlegung der
gewünschten Erbfolge zeichnete er –
ähnlich wie bei dem unten abgedruckten
Bild – mittels Pfeildiagramm auf, welche
Person von den Vermögensarten wie viel
erhalten soll. Die Ehefrau, die ohne Testa-
ment alles erhalten hätte, zweifelte dessen
Gültigkeit an. Das Oberlandesgericht
Frankfurt gab ihr Recht, obwohl ein hierzu
eingeholtes Schriftgutachten zum Ergebnis
kam, dass das gesamte Dokument mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
durch den Erblasser erstellt worden ist.
Schriftform ist eng auszulegen
Zweck der notwendigen Schriftform ist nach
Meinung der Richter, den wirklichen Willen
des Erblassers zu dokumentieren. Durch
die Schriftform wird der Erblasser auch
dazu angehalten, seinen letzten Willen
wohlüberlegt niederzulegen. Deshalb ist es
geboten, die Voraussetzungen eines eigen-
händigen Testaments eng auszulegen. Die
vom Erblasser gewählte Gestaltung als
Kombination aus handschriftlichen Worten
und einem Pfeildiagramm stellt nach
Auffassung des Gerichts keine eigenhän-
dige Schriftform dar. Denn eine mögliche
spätere Abänderung der Pfeile kann auch
durch ein Sachverständigengutachten nicht
überprüft werden.
Fazit:
Die Richter haben hier trotz des eindeu-
tigen Sachverständigengutachtens ein sehr
strenges Urteil gefällt. Deshalb ist dringend
von Diagrammen in einem Testament abzu-
raten, obwohl Bilder laut einer bekannten
Weisheit oft mehr als Worte sagen.
Die Pfändung von
Arbeitslohn