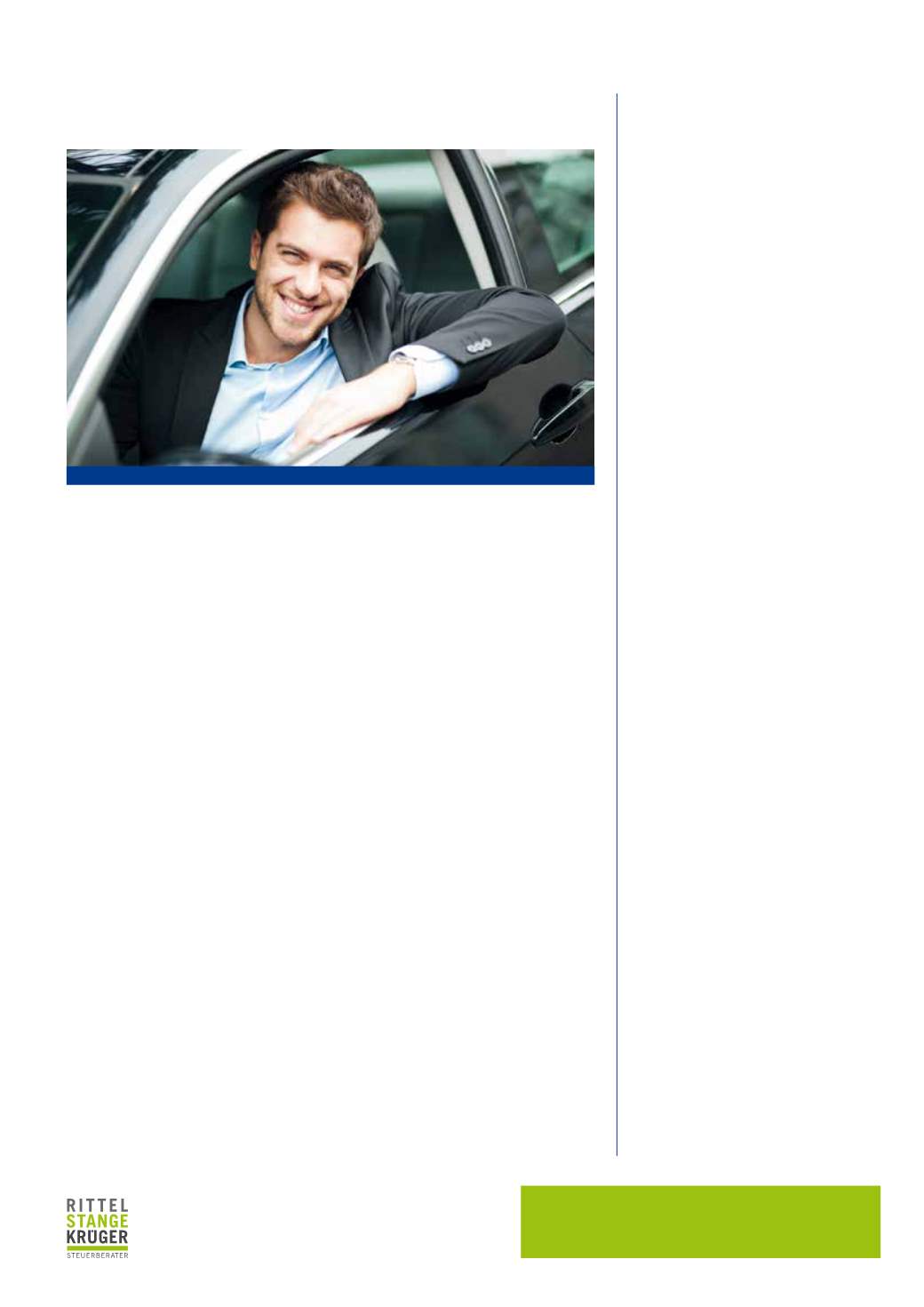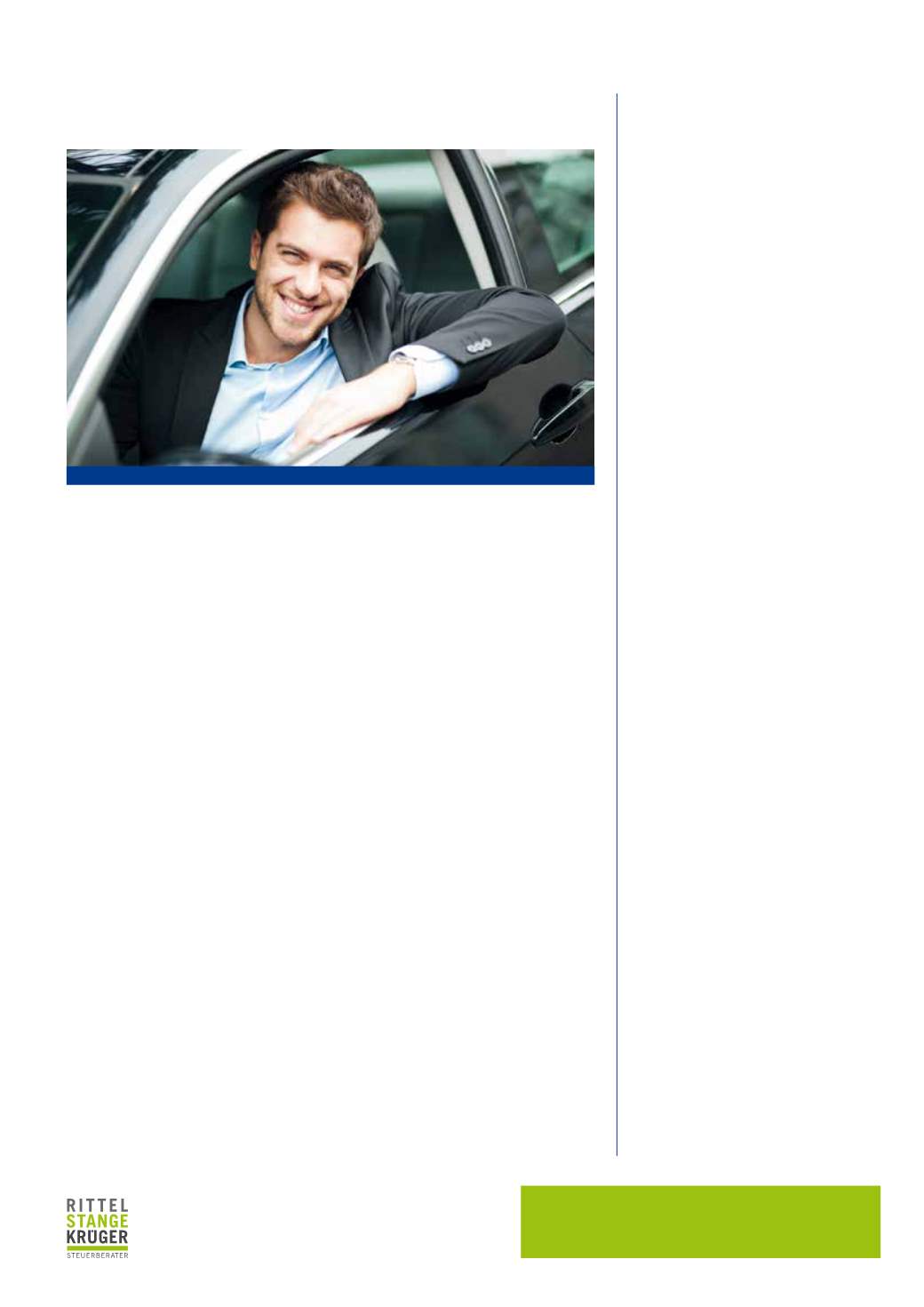
Impressum:
Rittel, Stange & Krüger Steuerberatungsgesellschaft mbH
10318 Berlin · Ehrenfelsstr. 44 ·Tel. 030-50 89 89 90
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt, ohne
Gewähr und können eine persönliche Beratung durch uns nicht ersetzen!
4
Wie man Urlaub
vererben kann
E i n k o mm e n s t e u e r
Private Kfz-Nutzung bei Nutzungsverbot?
Kann die Steuer auf den geldwerten
Vorteil wegen Privatnutzung eines
betrieblichen Pkw vermieden werden,
indem ein privates Nutzungsverbot
vereinbart wird?
Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeit-
nehmer unentgeltlich einen Dienstwagen
auch zur privaten Nutzung, führt dies zu
einem als Lohnzufluss zu erfassenden
steuerbaren Nutzungsvorteil des Arbeit-
nehmers. Dies gilt nach der gefestigten
Rechtsprechung unabhängig davon, ob
und in welchem Umfang der Arbeitnehmer
den betrieblichen Pkw tatsächlich privat
nutzt.
Bei fremden Arbeitnehmern wird von einer
Steuer abgesehen, wenn das Nutzungs-
verbot überwacht wird, z. B., wenn der
Arbeitnehmer nachweisbar den Firmen-
Pkw übers Wochenende und im Urlaub
am Firmengelände lässt. Zweifel an der
Ernsthaftigkeit eines ausgesprochenen
Nutzungsverbots treten immer dann auf,
wenn es gegenüber dem alleinigen oder
familienangehörigen Geschäftsführer
eines Familienunternehmens oder einem
Gesellschafter-Geschäftsführer erklärt
wird. Denn hier fehlt es an einer wirk-
samen Kontrolle.
Nutzungsbefugnis kontra
Nutzungsmöglichkeit
Ein ähnlicher Fall ohne Kontrollmöglich-
keit landete jüngst beim Bundesfinanzhof.
Es handelte sich um den Sohn und
faktischen Geschäftsführer der Firma des
Inhabers. Das Finanzamt setzte Steuern
auf die Pkw-Überlassung fest, obwohl ihm
vertraglich jegliche Privatnutzung unter-
sagt war. Die Richter hielten es zwar nicht
für rechtmäßig, dass die Finanzverwaltung
ohne jegliche weitere Nachforschungen
das vereinbarte Nutzungsverbot nicht
für stichhaltig erachtete. Sie warfen dem
untergeordneten Finanzgericht mangelnde
Sachverhaltsaufklärung vor. Es darf das
Nutzungsverbot nur dann nicht aner-
kennen, wenn diese Gewissheit auf einer
logischen, verstandesmäßig einsichtigen
Würdigung beruht, deren nachvollzieh-
bare Folgerungen den Denkgesetzen
entsprechen. Die Finanzrichter hätten sich
von der tatsächlichen privaten Nutzungs-
befugnis zu überzeugen. Sie könnten
nicht allein aus der fehlenden Überwa-
chung eines vereinbarten Verbots auf die
Nutzungsmöglichkeit schließen.
Ausblick
Der Urteilsfall ist vielleicht deshalb sehr
bürgerfreundlich ausgefallen, weil es sich
beim Betriebsfahrzeug um einen Audi A6
handelte und auf den Sohn ein Porsche
911 zugelassen war. Kann der Arbeit-
nehmer nicht nachweisen, dass er zu
Privatfahrten ein höherwertiges Fahrzeug
zur Verfügung hat, wird unseres Erachtens
einer Verbotsvereinbarung sicher weniger
Vertrauen geschenkt.
A r b e i t s r e c h t
Ein Arbeitnehmer verliert nach einem
Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs vom 12.06.2014 mit dem Tode
nicht seinen Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub. Die bisher in Deutschland
gegenteilige Ansicht ist damit vom
Tisch.
Wer stirbt, braucht keine Erholung mehr.
Diese kürzlich sogar vom Bundesar-
beitsgericht festgestellte Meinung gilt
nun nicht mehr. Gegen die restriktive
Handhabung wandte sich die Witwe
eines im November 2010 verstorbenen
Arbeitnehmers. Ihr Mann war seit 1998
in einer Firma beschäftigt. Wegen
Krankheit war er von 2009 an nur mit
Unterbrechungen arbeitsfähig. Als er im
Jahr darauf verstarb, hatte er noch 140,5
Tage Resturlaub. Seine Witwe verlangte
für den Urlaubsanspruch einen finan-
ziellen Ausgleich. Der Fall ging bis vors
Landesarbeitsgericht Hamm, welches
das Verfahren aussetzte und es dem
Europäischen Gerichtshof vorlegte.
Die Urteilsgründe
Nach ständiger europäischer Rechtspre-
chung ist der Anspruch jedes Arbeit-
nehmers auf bezahlten Jahresurlaub
ein besonders bedeutsamer Grundsatz
des Sozialrechts. Unstreitig ist auch,
dass ein Arbeitnehmer Anspruch auf
eine finanzielle Urlaubsabgeltung hat,
wenn sein Arbeitsverhältnis endet und
es deshalb nicht mehr möglich ist, dass
er seinen Urlaub nimmt. Ein finanzi-
eller Ausgleich ist unerlässlich, um die
praktische Wirksamkeit des Anspruchs
auf bezahlten Jahresurlaub herzu-
stellen. Würde der Anspruch durch
Tod des Arbeitnehmers verfallen, hätte
dies zur Folge, dass ein unwägbares,
weder vom Arbeitgeber noch vom
Arbeitnehmer beherrschbares Ereignis
rückwirkend zum vollständigen Verlust
des Anspruchs auf bezahlten Jahresur-
laub führt. Die Richter stellten zudem
fest, dass eine solche Urlaubsabgeltung
nicht davon abhängig gemacht werden
kann, dass im Vorfeld (also noch zu
Lebzeiten) ein entsprechender Antrag
gestellt worden ist.
Gut lachen hat, wer beweisen kann, dass er ein Dienstfahrzeug nur beruflich nutzen darf.
©MinervaStudio - Fotolia.com